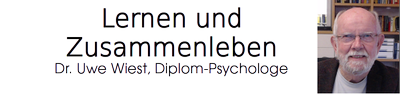|
Lebensqualität durch persönliche Beweglichkeit
Wenn du Lust hast, deine
Beziehungen zu
anderen Menschen befriedigender zu gestalten, wenn du dich besser
fühlen und deine persönliche Ausstrahlung erhöhen möchtest, ist
es sinnvoll, ab und zu Neues zu versuchen und dadurch zu
lernen.
Stelle Vermutungen an, was sich ändert, wenn du dich
anders verhältst, probiere es und werte es aus. Ist es so gekommen,
wie du gedacht hast, bist du überrascht worden?
Wenn du das tust, bist du dein
eigener
neugieriger Wissenschaftler. Merke: Nur wer beweglich ist, bewegt
etwas.
-------------------------
--------------------------
Du bleibst du. Aber du bist flexibel.
Ab und zu dein
persönliches Update
Erst einmal
alles durchlesen. Im folgenden immer ein Thema zur Zeit
behandeln. Jedes Thema verdient eine gründliche Beachtung..
Lange Zeit weißt du, wie du mit den an dich
gestellten
Anforderungen des Lebens umgehen musst und wie du es dir schön
machen kannst.
Dann kommt eine Situation, die du nicht so gut
bewältigst. Weil es zum Beispiel Veränderungen gibt, auf die du
keinen Einfluss hast.
Da braucht man einen Reiseführer. Wie bei einer Reise
durch die Galaxis. Douglas Adams.
 Dein Leben hat oft Überraschungen bereit, nicht immer
angenehme.
Da kannst du nicht immer einfach so weiter machen. Da werden neue
Anforderungen an dich gestellt. Dein Leben hat oft Überraschungen bereit, nicht immer
angenehme.
Da kannst du nicht immer einfach so weiter machen. Da werden neue
Anforderungen an dich gestellt.
Dann sagst du:
Ich kann nicht aus
meiner Haut.
Es sind die
Umstände,
damit muss ich mich abfinden.
Es liegt an den
anderen,
die müssen sich ändern.
Die anderen müssen
mich
so nehmen wie ich bin.
oder in einem Satz:
Ich will so bleiben
wie
ich bin.
Die Antwort ist:
Wer nichts wagt,
der
nichts gewinnt.
Oder: wie es so schön in der zweiten Strophe des
Lieds "The Rose" ausgedrückt ist:
It's
the heart afraid of
breaking
That
never learns to
dance
It's
the dream afraid of
waking
That
never takes the
chance
It's
the one who won't
be taken
Who
cannot seem to give
And
the soul afraid of
dyin'
That
never learns to
live.
Es muss aber auch gar nichts Dramatisches im
Leben
eintreten. Es ist manchmal auch nur die fehlende Perspektive, Dinge,
die einem Freude gemacht haben, werden in ihrer Wirkung immer
blasser. Die Tage schleppen sich dahin. Du fühlst dich belastet oder
gar überlastet - oder leer und gelangweilt, oder alles gleichzeitig
(das gibt es auch!).
Dann ist es Zeit, etwas zu verändern.
Nicht mit dem Brecheisen.
Man muss ja nicht gleich waghalsig werden.
Man
muss ja nicht komplett ein anderer Mensch werden.
Etwas an sich
feilen. Ein wenig sich selber modellieren.
Das kann Freude machen. Man erlebt
sich und andere neu, man erfährt positive Überraschungen. Man baut
Befürchtungen ab.
Probiere
es aus
Manche Dinge sind übersichtlich, Sie können sie relativ leicht
ändern.
Bei einigen Vorhaben merken Sie Änderungen nicht gleich, dann
sind Sie schnell entmutigt. Daher ist es gut,
ein Tagebuch zu führen,
Situationen
aufzuschreiben (wann, wie, wo, wer war dabei, Erfolgsbewertung)
oder, als Ergänzung oder als
Alternative
eine Häufigkeitstabelle anzulegen
(wie oft habe ich etwas gemacht, wie viel mal war ich erfolgreich?).
Waagerecht: Datum, Senkrechte: Häufigkeit.
Gewohnheiten
Was man immer tut, was man gewohnt ist, das
fühlt
sich richtig an. Was man nicht gewohnt ist, fühlt sich falsch an.
Wenn man bei seinen Gewohnheiten bleibt, kennt man die
Auswirkungen. Man nimmt sie in Kauf, auch wenn sie manchmal oder oft
unangenehm sind. Denkt oder handelt man anders, weiß man nicht, was
dabei herauskommt. Da macht unsicher.
Ein schöner Abend ohne Alkohol?
Eine Gesellschaft, bei der man nicht redet? Oder ausnahmsweise
doch mal redet?
Eine Beziehung ohne Zank und Geschrei? Wie fade.
Eine Stunde ohne Smartphone, Fernsehen, Musik aus der
Konserve,
einfach nur so da sitzen? Da muss man doch an die Decke gehen!
Einfach essen, wenn du Appetit hast? Du hast schon das Bild
vor
Augen, wie fett du sein wirst.
Sich mal nicht schminken? Wie sieht das denn aus?
Gewohnheit und Sucht, das wird fälschlicherweise leicht in
einen
Topf geworfen. Computer- oder Smartphone-Sucht ist eine starke
Gewohnheit. Nicht mit dem Smartphone zu hantieren, fühlt sich falsch
an.
Soziale Gewohnheiten: Der Mensch neigt dazu, sich unter
solchen
Menschen zu bewegen, die ähnliche Gewohnheiten haben, und die einen
darin bestärken, dass diese Gewohnheiten richtig sind.
Probiere
es aus
Erweitere mal gelegentlich mit deinem Verhalten. Um neue,
vielleicht gute Erfahrungen zu sammeln.
-
Wer ständig redet, sollte mal schweigen.
-
Wer ständig in Bewegung ist, sollte den Körper mal ruhig
halten.
-
Wer mürrisch ist, sollte mal freundlich sein.
-
Wer immer im Mittelpunkt stehen will und muss, sollte sich
mal zurückhalten und beobachten.
-
Wer schwer Kontakte findet, sie aber auch gar nicht sucht,
sollte sich mal dazu stellen, wenn andere eine kleine Gruppe bilden und
sich unterhalten.
-
Wer sein Kleingeld zusammen hält, sollte mal einen
ausgeben.
-
Wer immer Recht hat, sollte anderen mal recht geben.
-
Wer immer in Eile ist, sollte mal trödeln.
-
Wer immer gebeugt umherschleicht, sollte mal aufrecht und
zügig gehen.
-
Wer sich schlecht behandelt fühlt und das nie äußert, aber
sich lange grämt, sollte sich beim nächsten Mal wehren.
-
Wer immer an anderen herummeckert, sollte mal loben.
-
Wer immer bei seinen eigenen Gedanken ist, sollte mal
anderen ein längeres Stück zuhören.
-
Wer immer gern als Zuhörer gebraucht wird, aber übergangen
wird, wenn er selber etwas erzählen will, sollte das sagen.
-
Wer sich meistens bedienen lässt, sollte mal etwas für
andere tun, seine Dienste anbieten.
-
Wer immer für andere da ist, andere bedient, sollte seinen
Service mal einschränken und etwas für sich tun.
-
Wer nie etwas richtig zu
Ende macht, nimmt sich mal eine Sache vor und bringt sie zum Abschluss.
Aus der Rolle fallen
Im Theater oder Film verkörpern die Schauspieler bestimmte
Rollen. Bei guten Werken können diese Rollen durchaus differenziert
sein.
Im Alltag stelle ich auch so eine Rolle dar, ich sehe mich in
einer ganz bestimmten Weise, und ich könnte für mich sogar ein
Drehbuch schreiben. Das ist eine interessante Vorstellung: sich
selber zu spielen.
Dazu passend gibt es das Fremdbild, wie andere Menschen mich
sehen. Das Fremdbild ist oft sogar präziser als das Selbstbild, es
zu erforschen, birgt manchmal Überraschungen.
Bei den Disney-Figuren gibt es klare Rollenkonzepte: den
Glückspilz Gustav Gans, den reichen Geizkragen Dagobert Duck, den
sich selbst überschätzenden sympathischen Looser Donald Duck, die
altklugen Neffen Tick, Trick und Track, die Panzerknacker, die immer
am Ende die Dummen sind, aber immer weiter an ihre Erfolgsaussichten
glauben, der große böse Wolf, gefährlich, aber ziemlich erfolglos,
muss sich von seinem moralisch-guten Sohn retten lassen. Daniel
Düsentrieb, der kreativ ist aber trotzdem nie so recht erfolgreich.
Probiere es aus
Stellen Sie sich einige Szenen aus Ihrem Leben, erst einmal in
der
Gegenwart, vor, in der Sie mitspielen. Es können Szenen sein, wie
man sie in Fernsehspielen und Kinofilmen sieht.
Welche Rolle spielen Sie in diesen Szenen?
Beispiele:
Sind Sie ...
der gutmütige Mensch, den nichts
aus
der Ruhe bringt, der aber auch ein bisschen langweilig ist, weil er
nichts so recht an sich herankommen lässt?
der aufbrausende und ständig
herumzeternde Mensch? Lassen Sie kein gutes Haar an anderen Menschen?
Kann man es Ihnen nicht recht machen?
die Frau, die immer ihre
Unterstützung
gewährt, aber nie so recht bemerkt wird, und die immer grauer und
unscheinbarer wird? Die auf den Prinzen wartet, der ihre wahren
Talente entdeckt?
die Prophetin, die allen erklärt,
wie
man richtig leben soll?
die Erzählerin oder der Erzähler,
der oder dem man gern zuhört?
die Person, die es schafft, mit
Witz
und Humor brenzlige Situationen zu entspannen?
die Person, die alles mit dem
Hintern
umschmeißt, was sie vorn aufgebaut hat?
die oder derjenige, die überall
Unruhe und Chaos erzeugt?
die charmante Person, die zwar
viel
Mist macht, der man aber eigentlich nie etwas übel nimmt?
ein Mensch, der bei anderen
Beklemmungen, Erstarrung, Angst auslöst?
eine mutige und auch zum
Leichtsinn
neigende angstfreie Person?
Um Ihre spezielle Rolle oder ihre speziellen Rollen
herauszufinden, denken Sie an Situationen, die anscheinend immer mit
dem gleichen Ergebnis für Sie ablaufen, in der Familie und anderen
Beziehungen, im Beruf ...
Und wozu das Ganze?
Wenn Sie etwas über diese oder jene Rolle herausgefunden
haben:
welche Rolle gefällt Ihnen, welche eigentlich weniger? Könnten Sie
sich vorstellen, in Ihrem Drehbuch mal eine andere Rolle zu
spielen?
Oder das Drehbuch für diese Rolle ein wenig
umzuschreiben?
Man spielt ja oft auch nur deswegen eine Rolle, weil die
attraktiveren Rollen schon von anderen besetzt sind.
Beispiel: Sie werden immer
schnell
wütend und können dann nicht mehr klar denken. Das wissen andere
und provozieren Sie.
Wenn Sie sich also solche Szenen vorstellen, bedenken Sie auch
die
Rollen der anderen "Mitspieler".
Freundlicher Kontakt
Prinzipiell: an sich denken, aber auch an die anderen denken,
wie
es denen wohl mit deinem Verhalten geht.
Distanz und Nähe:
-
Freundliches Gesicht, zugewandte Körperhaltung, bewusst
den Augenkontakt suchen und lächeln.
Händedruck mit angemessener Spannung.
-
Belanglose Bemerkung machen, die jeder akzeptiert „Schönes
Wetter heute, aber kalt“, irgendwas Positives sagen: (Getränkemarkt:
Ihr Bier soundso schmeckt wirklich sehr lecker“).
-
Jemanden in der Schlange vorlassen, Geduld im
Straßenverkehr, wenn vor einem einer offensichtlich eine Straße sucht.
Nicht verwechseln mit Ausweichen, Nachgeben gegenüber
dominantem Verhalten. Merke: freiwillig auf die Wahrung eines Rechts
verzichten ist etwas anderes als ängstlich zurückweichen.
Probiere
es aus
Beschreibe, was die Leute von dir denken und empfinden, wenn
du
dich wie oben verhältst.
Probiere mal etwas und beobachte, was es bringt.
Wenn du dagegen andere gern vor den Kopf stößt und deinem Ansehen
unbedingt schaden willst:
Schlaffer oder quetschender Händedruck beim Begrüßen,
woanders Hingucken.
In jeder Situation aggressiv auf seinen Rechten Bestehen.
Mit finsterem Gesicht Schweigen.
Dauerreden
Sich unangemessen kleiden, ungepflegt sein (Geruch,
unsaubere Kleidung).
Breitbeinig im öffentlichen Nahverkehr sitzen, dass der
zweite Platz kaum benutzt werden kann.
Smartphone laut stellen, laut telefonieren, damit alle in
Bus und Bahn deinen Worten lauschen können.
Gespräch
Ein Gespräch findet zwischen zwei oder mehreren Menschen
statt.
Zu einem richtigen Gespräch gehört, dass alle beteiligt sind. Wenn
nur einer redet, ist es ein Vortrag oder Monolog.
Gespräche dienen verschiedenen Zwecken und Zielen. Es ist gut,
wenn man sich selber darüber im Klaren es, welchen Zweck und welches
Ziel ein Gespräch hat.
In Gesprächen finden ganz unterschiedliche Dinge statt:
Zuhören,
sich selber offenbaren, dann
spricht
man von sich selber,
informieren, dann hält man einen
kleinen Vortrag,
belehren, jemanden Rat geben,
jemandem
sagen, was sie oder er tun soll,
bewerten, man findet etwas gut
oder
weniger gut oder schlecht,
Übereinstimmung oder Widerspruch
äußern,
Wünsche oder Ziele benennen ...
Man kann das Gesprächsverhalten oder Gesprächsphasen auch nach
Rollen benennen:
der Psychotherapeut,
der Lehrer, der Chef, der Freund, die Eltern, der Prediger, der
Verkäufer ...
Probiere
es aus
Zeichne mal ein Gespräch auf und benenne die Merkmale des
Gesprächs.
Du kannst auch einfach aus der Erinnerung zu folgenden Fragen
Stellung nehmen:
Gehen die Teilnehmer aufeinander
ein?
Wie machen sie das?
Woran merkt man, dass jemand
zuhört
oder mit seinen Gedanken ganz woanders ist?
Wie beeinflussen die Teilnehmer
einander?
Macht jemand Druck, und wenn, wie?
Welche Verhaltensweisen führen zu
mehr Äußerungen der anderen, welche stoppen das Gespräch?
Woran merkt man Anspannung und
Entspannung?
Welche
ausgesprochenen und unausgesprochenen Meinungen gab es?
Zuhören
Menschen reden gern. Wer selber ständig redet und nicht
zuhört,
erfährt viel von sich selbst und nichts von anderen. Machen Sie die
Probe aufs Exempel: Sie waren in Kroatien oder in der Karibik. Kaum
zwei Sätze gesagt, da werden Sie mit den Urlaubserfahrungen anderer
vollgetextet.
Berater geben gern Rat-Schläge. Sie wissen dann schon, was für
andere gut ist. Sie haben ja so viele Erfahrungen, sie brauchen gar
nicht genau zu wissen, wie die Lage der Person ist, der sie raten.
Zum Zuhören hat man einfach keine Zeit – oder keine Lust.
Beraten ohne Zuhören ist eine vergebliche Kunst. Beraten ohne
Zuhören macht schlechte Gefühle. Es ist ermüdend, wenn
ausschließlich Allein-Unterhalter am Werk sind. Das gilt auch für
Unterrichtsgespräche, wenn Lehrer so steuern und dominieren, dass
Schüler-Äußerungen nur Versatzstücke, Lückenfüller sind.
Wer in Kontakt mit anderen Menschen kommen will, etwas von
ihnen
erfahren will und eine Überzeugung, ein Nachdenken, eine persönliche
Entwicklung fördern will, muss zuhören können.
Die Grundlage des Zuhörens ist Neugier auf eine andere Person
oder eine Gruppe.
Zuhören kann passiv sein: einfach nichts sagen, andere reden
lassen, dabei eine zugewandte mimische und körperliche Haltung
zeigen: Blickkontakt, sich leicht vorbeugen, Lächeln, mit dem Kopf
nicken. Man kann ermunternde Fragen stellen: „Erzähle doch mehr
darüber.“ Oder Bemerkungen wie „Aha“, „Hmhm“.
Man kann nach weiteren Details fragen, oder um eine weitere
Erklärung bitten, wenn man etwas nicht ganz verstanden hat.
Zum Zuhören gehört auch, dass man nicht bewertet oder
Suggestiv-Fragen stellt. Also nicht: „Meinst du, dass das richtig
war?“ „Hättest du nicht stattdessen lieber das und das machen
sollen?“
Sie können Äußerungen Ihres Gesprächspartners auch einfach
wiederholen oder in eigenen Worten wiedergeben.
Probiere
es aus
Versuche mal, einige Minuten nur zuzuhören. Verzichte auf
deine
Meinungen, Ideen, Bewertungen, enge Fragen, die jemand nur mit „Ja“
und „Nein“ beantworten kann. Horche in dich hinein, macht dich
das kribbelig? Gehen dir tausend Sachen durch den Kopf, die du jetzt
gerne sagen würdest? Fühlt sich dein Gesprächspartner wohl, redet
sie oder er weiter, wenn du zuhörst?
Notiere anschließend deine Beobachtungen und Erfahrungen.
Einfühlen
Will man die innere Welt, das heißt Gedanken, Gefühle,
Empfindungen, einer Person kennen lernen, und will man einer Person
helfen, ihre Gedanken in Ruhe zu entwickeln, fühlt man sich ein.
Wie geht das? Du formulierst das, was dein Gegenüber sagt, in
eigenen Worten.
A. „Ich vertrödel immer ganz viel
Zeit, bevor ich mit den Hausaufgaben anfange.“
B. „Du kriegst einfach nicht den
Dreh, sofort loszulegen.“
A. „Ja, und dann habe ich ganz
lange
da gesessen und wenig geschafft.“
B. „Und das ärgert dich dann,
wenn
es wieder so gelaufen ist.“
Man geht immer auf den vorigen Satz ein. Man ist sozusagen ein
Echo, das Gegenüber kann dann bewerten, ob es genau das ist, was es
gemeint hat, oder nicht ganz, und es dann entsprechend modifizieren.
Diese Art des Gesprächs kann man auch Begleiten nennen. Du
bist
immer ziemlich genau auf der Höhe der Gedanken, die dein Gegenüber
gerade entwickelt.
Auf den ersten Blick klingt diese Art der Gesprächsbegleitung
vielleicht umständlich. Der Gesprächspartner lernt aber dabei: sie
oder er wird nicht bedrängt. Sie kann ihre Gedanken entfalten, ohne
von dir abgelenkt oder ausgebremst zu werden.
Probiere
es aus
Einfühlen im Gespräch, das ist auch Übungssache. Fange einfach
damit an, dass du die Äußerungen deines Gesprächspartners wiederholst.
Das wird dir komisch vorkommen, aber die Erfahrung
zeigt, dass Gesprächspartner schon das als angenehm empfinden.
Mit einiger Erfahrung lernst du, dich etwas kürzer und dichter
zu
äußern und andere Worte zu gebrauchen, oder dich bildhafter
auszudrücken.
Probiere es mal mit Leuten aus, mit denen du gut befreundet
bist
und lasse dir sagen, wie deine Art des Einfühlens ankommt.
Zeichne mal eine Gesprächs-Sequenz auf und überlege mit deinem
Trainingspartner, wie treffend du dich eingefühlt hast, und was man
sonst noch hätte sagen können.
Schreibe mal auf, was du normalerweise gesagt hättest und
frage
deinen Partner, wie das angekommen wäre.
Fragen
Warum fragen Menschen?
Fragen erkennt man schriftlich am Fragezeichen, mündlich an
der
am Satzende angehobenen Stimme. Ansonsten haben sie wenig gemeinsam.
Lehrerin: Warum hast du Thomas
geschlagen? (Schüler: Ich weiß es selber nicht, aber ich muss jetzt
irgendwas Geschicktes antworten).
Verkäufer: Bietet der Toaster
nicht
wirklich viel für sein Geld? (Ich brauche keinen Toaster)
Sie: wollen wir Essen gehen oder
lieber
ins Kino? (Ich möchte zu Hause bleiben, aber das sage ich lieber
nicht)
Er: liebst du mich wirklich? (Was
ich
auch antworte, es kann nur falsch sein)
Lehrer: hat Felix richtig
gerechnet?
(Ja oder Nein)
Eltern: wie war es in der Schule?
–
Gut. (Kind weiß, es geht nicht darum, Eltern beunruhigende Dinge zu
sagen. Aber auch nicht, dass einige Dinge Spaß gemacht haben. Es
geht vielmehr darum, wenig zu sagen und damit kein Öl ins Feuer zu
gießen).
Eine gute Retourkutsche, wenn man
eine
Frage nicht beantworten möchte: „Warum fragst du?“
Fragen dienen verschiedenen Zwecken:
Jemand will eine Information, einen in Verlegenheit bringen,
einem
Alternativen aufzwingen, seine eigene Sorge besänftigen (was so
nicht gelingt), Überlegenheit zeigen (Warum fragt der Lehrer Sachen,
die er doch schon weiß?). Manche Fragen beinhalten gleich eine
Bewertung. „Findest du das richtig, kleine Kinder zu ärgern?“
Fragen können aber die befragte Person in ihrer Phantasie
beflügeln, Nachdenken fördern..
Enge Fragen sind eindimensionale Fragen, die nur wenige
Antworten
zulassen. Der Gefragte ist in dem Gespräch eigentlich nur Statist.
Weite Fragen lassen der befragten Person Spielraum, weite
Fragen
stimulieren und setzen wenig unter Druck. Sie ermöglichen einen
Austausch von Gedanken.
Zirkuläres Fragen –
das ist so Etwas wie Klatschen mit Anwesenden: man wird nach
Meinungen über andere gefragt statt über sich selber reden zu
müssen. Dabei geht es um Vergleiche.
Wer ist noch so unordentlich wie
Thomas? Wer ist am ordentlichsten?
War Thomas immer schon
unordentlich?
Wann war er am ordentlichsten?
Wenn Thomas unordentlich ist, wer
regt
sich darüber am meisten auf?
Wer kann Thomas am ehesten dazu
bewegen, aufzuräumen?
Wenn Thomas plötzlich ganz
ordentlich
wäre, wer hätte am meisten davon?
Was würde geschehen, wenn Thomas
noch
viel unordentlicher würde?
Wer würde als erster bemerken,
wenn
Thomas seine Sachen aufräumt?
Gibt es jemanden, der früher auch
unordentlich war? Wie hat sie oder er zur Ordnung gefunden?
Welche Vorteile hat Thomas davon,
unordentlich zu sein?
Wer würde sich mehr und wer würde
sich weniger um Thomas kümmern, wenn er ordentlich wäre?
Was würde geschehen, wenn alle
unordentlich würden?
Würde es Thomas dann besser oder
schlechter gehen?
Zirkuläre Fragen
beinhalten explizit den Beziehungs- und den
Inhaltsaspekt:
Statt:
„Was hast du gesehen?“ „Was denkst du, was er gesehen
hat?“
Statt:
„Wie siehst du das Problem?“ „Was denkst du, wie sie das
Problem sieht?“
Zirkuläre Fragen erweitern die Perspektive. Auf andere
Personen,
auf Zusammenhänge, unterschiedliche Zeiten, auf die Zukunft. Es wird
in verschiedene Richtungen geblickt. Das System wird ausgeleuchtet,
statt isoliert eine Person. Daher werden zirkuläre Fragen auch
systemische Fragen genannt.
Zirkuläre Fragen sind Vergleichsfragen. Verschiedene Personen,
Verhaltensweisen, Bewertungen, Zeitpunkte werden miteinander
verglichen. Vergleiche führen weg vom Absoluten zum Relativen.
Mit zirkulären Fragen bringt man eine Person mit Defiziten aus
der Defensive und macht sie zur Mit-Forscherin.
Probiere
es aus
Stelle weite Fragen, zirkuläre Fragen. Beobachte dabei deine
Gefühle. Achte darauf, wie sich deine Sichtweise von den Dingen
erweitert.
Fertige eine Liste an. Was kann man alles vergleichen?
Verhalten ändern
Grundlagen
-
Verhalten, auf das sofort eine positive Erfahrung folgt,
tritt häufiger oder verstärkt auf.
-
Bestimmte Ereignisse signalisieren dir: wenn du jetzt
etwas Bestimmtes tust, wirst du eine positive Erfahrung machen. Du
wirst es dann häufiger tun.
-
Wenn du bei anderen beobachtest, dass sie in einer
Situation mit einem bestimmten Verhalten positive Erfahrungen machen,
wirst auch du dich häufiger so verhalten.
-
Wenn auf ein Verhalten nur unregelmäßig positive
Erfahrungen folgen, wird es häufiger auftreten als wenn dies regelmäßig
der Fall ist (paradox aber vielfach bestätigt).
-
Wenn auf ein Verhalten nie eine positive Erfahrung folgt,
wird es verlernt.
-
Wenn auf ein Verhalten eine unangenehme Erfahrung folgt,
wird es vermieden, aber nicht verlernt. Sowie die unangenehme Erfahrung
nicht mehr erfolgt, tritt es wieder auf.
-
Unangenehme Erfahrungen werden mit der Situation
assoziiert, in der du dich verhalten hast - unter anderem mit Personen,
die dich Unangenehmes erfahren lassen. Das heißt, unangenehme Gefühle
wie zum Beispiel Zorn oder Angst werden in einer ähnlichen Situation
auftreten, auch wenn du dich gar nicht so verhalten hast.
-
Sofortige positive Erfahrungen führen zu mehr
entsprechendem Verhalten. Positive Erfahrungen zu einem späteren
Zeitpunkt bewirken wenig oder gar nichts.
-
Ein unerwünschtes Verhalten wird am ehesten verlernt, wenn
man es durch ein damit unvereinbares Verhalten ersetzt.
-
Die beste positive Konsequenz auf ein Verhalten ist: die
eigene Freude oder der Stolz über den Erfolg. Diese Konsequenz hat man
immer bei sich.
Wenn man diese Regeln auf sich selbst oder andere Personen
anwendet, gibt es ein Problem: man muss erst einmal herausfinden, was
das für Erfahrungen sind, die von der Person (von dir selber oder
von anderen), die als positiv erlebt werden.
Nr. 1 wird landläufig mit Lob gleichgesetzt. Lob wird aber vom
Empfänger oft gar nicht als angenehm erlebt.
Nr. 2 beschreibt eine Verhaltenskette. Eine Schülerin hat sich
für Französisch intensiv auf einen Test vorbereitet. Durch
konzentrierte Mitarbeit im Unterricht und gründliche Hausaufgaben.
Sie schreibt eine Eins. Sie wird sich fortan wieder oder sogar
intensiver vorbereiten - erst einmal beschränkt auf "Französisch",
denn da hat es funktioniert.
Nr. 3, Lernen durch Beobachtung, stellvertretendes Lernen, ist
ein
starkes Prinzip. Beobachteter Erfolg eines Verhaltens wirkt unter
Umständen so stark wie ein selbst erfahrenes positives Erlebnis.
Nr. 4 ist paradox, widerspricht eigentlich dem gesunden
Menschenverstand. Ein Kind, dass jedes 5. Mal erreicht, dass es
durch lautes Quengel etwas gekauft bekommt, wird künftig noch mehr
quengeln als das Kind, das immer sein Ziel erreicht. Das gilt ja auch
für Sportler und erklärt deren Hartnäckigkeit, ein Ziel erst nach
vielen Versuchen zu erreichen.
Nur Nr. 5, also das konsequente Ausbleiben des Erfolgs, führt
zum
Ausbleiben des Verhaltens. Das macht Erziehung so schwierig. Das
macht Hartnäckigkeit im Sport so wirksam.
Nr. 6, das ist die Strafe. Strafe führt nicht zum Verlernen,
sondern zum Vermeiden. Wenn sie ausbleibt, tritt das Verhalten wieder
auf. Das sieht man an Wiederholungstätern. Sitzt im Gefängnis,
kommt wieder heraus, bricht sofort wieder ein Auto auf.
Nr. 7 beschreibt die Nebenwirkungen von Strafen
beziehungsweise unangenehmen Verhaltens-Konsequenzen: die Situation, in
der diese
erfolgen, wird als Ganze zur Ankündigung unangenehmer Erlebnisse. So
entsteht Schulschwänzen: ständiger Ärger mit Lehrern und
Mitschülern, blamable Testergebnisse und andere Prüfungssituationen,
ausgelacht Werden, weil man etwas nicht kann zum Beispiel, erzeugt
schon beim Anblick des Schulgebäudes und bestimmter Lehrkräfte
Gefühle wie Angst und Wut und das dringende Bedürfnis, zu fliehen.
Nr. 8 besagt, dass die positive Konsequenz nur
verhaltenswirksam
ist, wenn sie so schnell erfolgt, dass die Person den Zusammenhang
von Tun und angenehmem Erleben unmittelbar erlebt. Langfristige
positive Folgen (das Fahrrad zu Weihnachten) sind nur wirksam, wenn
es auf dem Weg schon mal viele viele kleine positive Folgen gegeben
hat.
Nr. 9 : wenn es gelingt, das unerwünschte durch ein
erwünschtes
Verhalten zu ersetzen, das man nicht gleichzeitig mit dem
unerwünschten ausüben kann, und das gewünschte dann auch noch als
angenehm oder erfolgreich erlebt wird, wird das unerwünschte
Verhalten nachhaltig verlernt. Dabei ist natürlich Phantasie
gefragt. Passionierte Raucher können zum Beispiel bei fast jeder
anderen Tätigkeit rauchen. Aber Reden und Schweigen geht zum
Beispiel nicht gleichzeitig.
Nr. 10: "Ich bin nicht wütend geworden, sondern bin gelassen
geblieben. Ich habe tief durchgeatmet statt loszubrüllen." Ja,
darüber kann man erfreut und stolz sein.
Vorschläge
Eigenes Verhalten ändern.
Schieben Sie wichtige Dinge leicht vor sich her
(Prokrastination)?
Fangen Sie gleich an oder zu
einem
vorher festgelegten Zeitpunkt. Wenn Sie sich daran gehalten haben:
freuen Sie sich. Genießen Sie das Ergebnis. Machen Sie unmittelbar
danach etwa, was Ihnen Spaß macht. Sagen Sie sich, wie willensstark
sie wieder waren.
Merke: wenn Sie Zeit für ihre
Lieblingsbeschäftigung durch Aufschieben gewinnen, können sie das
meistens gar nicht richtig genießen. So aber gewinnen Sie ein reines
Gewissen. Die Erleichterung ist schon Belohnung.
Vergegenwärtigen Sie sich all
diese
Vorzüge.
Übrigens, wenn Sie gern mit
Listen
arbeiten: schreiben Sie auf, wie viel Mal sie nicht aufgeschoben
haben, zeichnen Sie mit den Daten eine Lernkurve! Die wird
hoffentlich ansteigen, das ist eine zusätzliche Belohnung.
Was möchten Sie gern an ihrem Verhalten ändern? Planen Sie ein
Programm. Mit Zielen, Zwischenzielen, Belohnungen. Welche positiven
Gedanken, Gefühle, Empfindungen möchten Sie mit der
Verhaltensänderung erreichen?
Beispiele: Überwinden von Angst, Jähzorn, Tabletten-, Drogen-,
Alkoholkonsum, Rauchen, Naschen im Übermaß.
Ersetzen Sie Entspannung durch Dinge, die Sie zu sich nehmen,
durch Entspannungstrining (Progressive Muskelentspannung, Autogenes
Training, Yoga).
Sie sind unordentlich, sie können nichts wegwerfen? Räumen Sie
auf, setzen sich danach hin und betrachten mit Freude ihren
aufgeräumten Schrank, die Küche ... Drei Sachen werfen Sie weg,
über eine freuen Sie sich, Sie wussten gar nicht, dass Sie die noch
haben. Es ist wie ein Neukauf.
Erziehung
Rechtzeitiges morgendliches Aufstehen. Angemessenes Arbeiten
für
die Schule. Aufräumen.
Schließen Sie mit ihrem Kind einen
Vertrag. Tägliche Buchführung. Wird er eingehalten: Belohnung mit
Punktesystem. Wie Treuepunkte im Supermarkt. Punkte werden
eingetauscht gegen Belohnung. Gespräch über Erfolge. Keine
negativ-Konsequenzen für Nicht-Einhalten, der nächste Tag wird ein
erfolgreicher Tag.
Überlegen Sie sich, welche Belohnungen für das Kind
erstrebenswert sind.
Liebevoll wahrnehmen
Du siehst genau hin und genießt den Anblick.
Die Geliebte oder den Geliebten.
Das
Kunstwerk. Die Landschaft. Ein Tier. Eine Pflanze. Den schönen
Gegenstand.
Ein Schmuckstück. Ein wertvoll eingebundenes und
gestaltetes Buch.
Dein Auto.
Dein Haus. Ein Kleidungsstück. Die Kamera … und – natürlich,
das neue Smartphone.
Ein Gegenstand mit symbolischer Bedeutung,
zum Beispiel ein Foto, ein Schmuckstück in Erinnerung an eine
Person.
Ein religiöses Symbol wie ein Kruzifix, ein Leuchter,
ein Gebetsteppich. Ein Kirchenfenster. Ein Muster in der Moschee.
Jeder Mensch, jeder Gegenstand gewinnt an Schönheit, wenn du
dir
die Muße nimmst, genau hinzusehen und Schönes zu entdecken.
Das gilt genau so für „liebevoll Anhören“, das Genießen von
Musik, Stimmen oder Naturgeräuschen.
Man kann auch Situationen genießen.
Eine Landschaft, ein Konzert,
eine
Ausstellung, eine Vorlesung oder Unterrichtsstunde, ein Zusammensein
mit Menschen, die man schätzt ...
Probiere
es aus
Beschreibe das Objekt deiner
wohlwollenden Betrachtung mit Worten. Was ist daran schön? Was
gefällt dir?
Werde ein Dichter!
Genieße einfach häufiger,
konzentriere dich auf die schönen Dinge und Situationen!
|