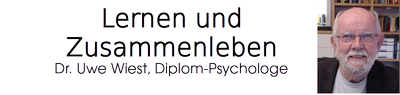
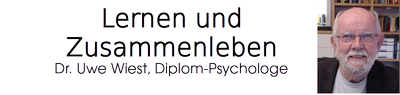
Die Verhaltenskette S-O-R-K-CIn Pädagogik und Sozialarbeit wird oft in vorwissenschaftlicher Weise mit Verhaltensbeeinflussung umgegangen. Stereotypes Loben und Belohnen, Verhaltensverträge, die keine sind, negative Konsequenzen für unsoziales Verhalten, die von den Betroffenen gar nicht als negative Konsequenz ankommen, so geht das bis zum heutigen Tag, obwohl die wissenschaftlichen Kriterien und deren sinnvolle Anwendung seit den Siebziger Jahren vorliegen. Das Standardwerk: James
G. Holland und B.F. Skinner (1971): Analyse des Verhaltens. Das Buch ist in Form des programmierten Lernens verfasst. Das heißt, der Lernstoff wird in kleinen Abschnitten dargeboten, die schriftlich beantwortet werden müssen. Verhaltensmodifikation in der Sozialarbeit: Roland
G. Tharp, Ralph J. Wetzel (1975): Verhaltensänderungen im gegebenen
Sozialfeld.
S ist die Situation, in der ein Verhalten auftritt.
O steht für Organismus, ein Sammelbegriff für genetische Voraussetzungen, bisherige Lernerfahrungen, die gegenwärtige Verarbeitung der Sinnesreize. O ist nicht unmittelbar beobachtbar, daher hieß O früher auch 'black box'.
R (Reaction) ist das Verhalten in der Situation.K ist das Muster der Konsequenzen auf das Verhalten (Kontingenz), also regelmäßig, unregelmäßig oder nach einem Plan, zum Beispiel jedes x-te Mal, alle X Minuten) C ist die Konsequenz: Belohnung, Bestrafung, Löschung=keine Konsequenz. Und hier die Erklärung weitere wesentlicher Grundbegriffe der Verhaltensmodifikation nach Holland und Skinner: zu K (Kontingenz): Die Konsequenz C kann
kontinuierlich
oder intermittierend erfolgen: mal ja, mal nein. Die intermittierende Verstärkung erfolgt nach einem Intervall-Plan (z.B. alle 5 Minuten), oder Quoten-Plan (z.B. jedes vierte Mal), regelmäßig, oder unregelmäßig. Intermittierende Verstärkung ist wirkmächtiger als kontinuierliche Verstärkung. Unregelmäßige wirkmächtiger als regelmäßige. SD ist ein Stimulus (Reiz), der eine Belohnung verspricht (C+) SΔ ist ein Stimulus, der eine unangenehme Konsequenz verspricht (C-), eine „Bestrafung“.
Bestrafen führt zur Vermeidung eines Verhaltens. Bleibt der aversive Reiz SΔ aus, tritt das Verhalten wieder auf. Löschen führt zum Verlernen eines Verhaltens. Taucht der verstärkende Reiz SD wieder auf, wird das Verhalten erneut gezeigt, dann dann handelt es sich um intermittierende Verstärkung statt Löschung. Wirksamer ist daher, das unerwünschte Verhalten durch eine anderes Verhalten zu ersetzen, das man nicht gleichzeitig ausführen kann (unvereinbares Verhalten). Verstärker SD - es gibt Belohnungen, die bei fast allen wirken und solche, die besonders bei bestimmten Personen wirken. Zur Verhaltensdiagnostik gehört daher, herauszufinden, was eine Person belohnt (verstärkt). Entsprechendes gilt für die Darbietung aversiver Reize SΔ. Beispiel: jemanden in der Unterrichtszeit nach Hause zu schicken, ist für die einen Bestrafung, für andere aber unter Umständen eine Belohnung. Die Verhaltenskette ist keine Gleichung im mathematischen Sinne, denn sie enthält kein Gleichheitszeichen. Sie stellt eine Folge dar, wobei die Kette eigentlich unendlich ist: die Konsequenz C ist gleichzeitig das S für eine nächste Folge. Nach Tharp und Wetzel (siehe oben) ist es nicht nur wichtig, was bei einer Person als Belohnung (C) wirkt, sondern wer im Umfeld der Person wirksame Belohnungen verabreichen kann. Vater, Mutter, Geschwister, Lehrer, Freunde, Sport-Trainer usw. Veranschaulichung.Beispiel 1 Eine Klassenarbeit steht an (S), du bereitest dich vor,
weil du
in der Vergangenheit damit gute Erfahrungen gemacht hast und weil
eine Belohnung winkt. Die Ankündigung der Klassenarbeit löst also Bilder und Gefühle in dir aus, diese steuern dich an den Schreibtisch. Du bereitest dich vor (R). Als Ergebnis bekommst du eine gute Note: C. Allerdings führen deine Bemühungen um eine gute Zensur nicht immer zum erwarteten Ergebnis. Ab und zu bekommst du eine gute, manchmal auch eine mäßige Zensur. Die Belohnung erfolgt also nicht regelmäßig, sondern nach dem Muster einer unregelmäßigen Quote. Das ist die Kontingenz K. Die Erinnerung an eine gute Note (C), genauer: an den Zusammenhang von Vorbereitung und Ergebnis, verknüpft sich mit dem nächsten S, der Ankündigung einer weiteren Klassenarbeit. So entsteht eine Verhaltenskette. Du gibst dir mehr Mühe, erhöhst deinen Einsatz, um noch häufiger noch bessere Ergebnisse C zu erzielen. Wenn du jedes Mal in einem Fach sehr gute Noten erhältst, ist dein Lernantrieb wohl geringer als wenn jede zweite oder dritte Arbeit gut ausfällt. Dabei muss natürlich im Hintergrund berücksichtigt werden, wie viel Anstrengung du überhaupt benötigst, eine gute Arbeit zu schreiben. Schreibst du nie eine
wirkliche gute Arbeit, wird dein Vorbereitungs-Antrieb möglicherweise
gelöscht. Wenn wir genauer hinsehen, ist die Konsequenz für eine gute Vorbereitung meistens ein Bündel von Konsequenzen. Die gute Note, das Wohlwollen der Lehrerin, die Freude der Eltern, ein Zuschuss zum Taschengeld und ein Zuwachs an Selbstvertrauen. Vielleicht auch die Bewunderung anderer Schüler und mehr Interesse am Inhalt des Gelernten. Vielleicht auch nur eins davon. Merkst du, dass keine Zusammenhang zwischen Vorbereitung und Ergebnis besteht, wird die Vorbereitung für dich irrelevant, du tust lieber etwas, was dir mehr einbringt. Mehr gutes C. Wenn wir noch genauer hinsehen, gibt es zwei Rs, nämlich die Vorbereitung und die Leistung während der eigentlichen Klassenarbeit. Man kann sich falsch vorbereiten, oder man kann in der Prüfungssituation nicht so gut denken wie am eigenen Schreibtisch. Der Gewinn C hängt also von beidem ab. Zum Verstehen einer Situation
im Sinne der Verhaltenskette ist
also keine mechanische Angelegenheit im Sinne eines
Tauben-Lern-Experiments mit Skinner-Box:
Futterspender, Licht- und Ton-Signal und Hebel. Es erfordert genaue
Beobachtung und Einfühlung, um das, was geschieht, zu analysieren
und diagnostizieren. Beispiel 2 Der Fußballstar
Steinschweiger erfährt, dass er für das nächste Spiel aufgestellt
und Spielführer ist. Diese Mitteilung ist das S, genauer das SD,
sie lässt ihn Gutes erwarten, wenn er sich anstrengt und zeigt was
er kann. Die bisherigen guten Erfahrungen kommen ihn in Erinnerung,
und die Glücksgefühle, die er hatte, wenn er Tore schoss oder gute
Flanken geschlagen hat. Oder dem Gegner davon gelaufen ist (O).
Daher ist er im Training hoch motiviert und
schreitet auf den Platz mit der Lust am Sieg, der Freude über die
johlenden Zuschauer, die
ganze Atmosphäre. Die Konsequenzen C sind der Sieg, der Beifall, das
Geknutsche seiner Mitspieler, das Entlanglaufen vor den Fans, die
Interviews im Fernsehen und die Gehaltssteigerung bei der nächsten
Vertragsverhandlung (Ah,
sofortige und aufgeschobene positive Konsequenz).
Manche Spieler sind immer gut und erfolgreich (regelmäßige
Verstärkung), manche manchmal (Quotenverstärkung), manche längere
Zeit nicht, die suchen sich einen anderen Verein, um wieder ins Spiel
zu kommen und belohnt zu werden, manche hören einfach auf. |